Wer sind wir - und wenn ja, wie viele?
Wie ist es, in einem System aufzuwachsen, das Sicherheit verspricht – aber nur für einige? Was macht es mit einem Kind, wenn das Leben der „Anderen“ zwar nicht sichtbar, aber doch spürbar nah ist? Und was bedeutet es, Teil einer kirchlichen Tradition zu sein, die Spuren von Mission, Ordnung – und Ausgrenzung – in sich trägt? Ulrich Meyer-Höllings nimmt uns mit in seine Jugend im Apartheid-Südafrika – und in seine innere Reise durch Spannungen, Fragen und Ahnungen. Ein persönlicher Text über Glauben, Privilegien und die Suche nach einem Ort, an dem Identität nicht eindeutig sein muss: dem „Dritten Raum“.
Ich bin im Pretoria der 1980er Jahre aufgewachsen – nicht in den staubigen Randzonen, sondern in den makellosen Vororten, wo die Hecken akkurat geschnitten und die Mülltonnen regelmäßig geleert wurden. Mein Alltag war sicher, strukturiert, privilegiert. Und doch lebte ich von früh an in einer Spannung, die ich nicht benennen konnte – zwischen dem, was ich sah, und dem, was ich wusste. Zwischen meiner Welt und jener Welt, die für andere Menschen in diesem Land Alltag war – hart, gefährlich, entrechtet.
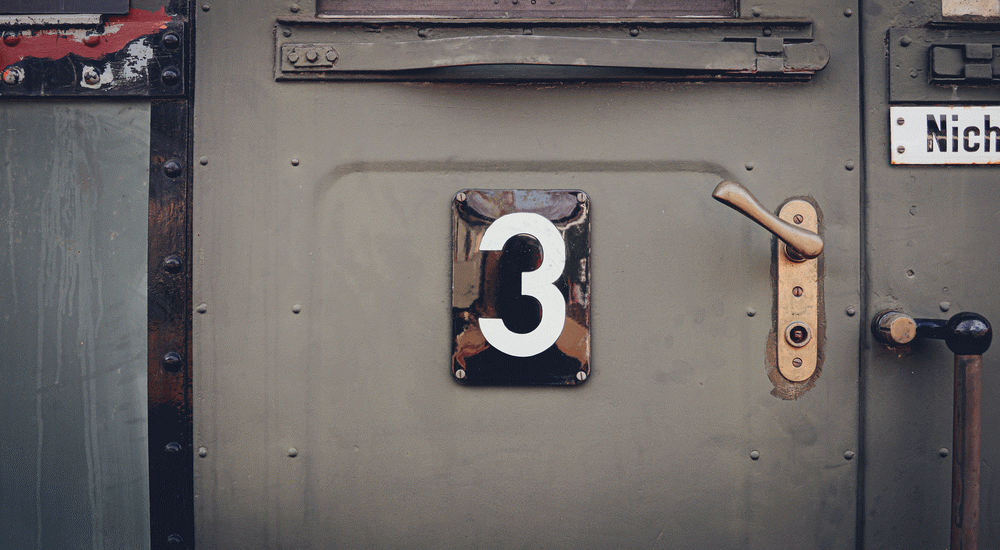 © Foto: Anatol Rurac/unsplash | Wie konstruiert sich Identität in postkolonialen Kontexten? Eine Theorie ist die des „Dritten Raums“ von Homi K. Bhabha.
© Foto: Anatol Rurac/unsplash | Wie konstruiert sich Identität in postkolonialen Kontexten? Eine Theorie ist die des „Dritten Raums“ von Homi K. Bhabha.
Meine Großeltern hatten als Hermannsburger Missionar*innen unter den Bafokeng im ländlichen Raum gearbeitet. Ihre Erzählungen – vom Teilen des Lebens, vom mühsamen Lernen der Sprache, vom Zuhören – prägten meine Kindheit auf subtile Weise. Und obwohl meine Eltern selbst nicht mehr als Missionar*innen aktiv waren, spürte ich, dass in unserem Familiengedächtnis etwas mitschwang, das über unsere gepflegten Rasenflächen hinauswies.
Ein dritter Raum?
Auch in den Kirchengemeinden meiner Jugend waren viele Menschen, die entweder direkte Nachfahr*innen von Missionar*innen waren oder durch diese entscheidend in ihrer Biografie geprägt wurden. Die überwiegend deutschsprachige Gemeinde in Pretoria war so etwas wie „Heimat in der Fremde“ und ein bisschen schwang auch immer der zivilisatorische Aufklärungsauftrag der Vorfahr*innen mit. Die Erfüllung des eigentlichen „Missionsbefehls“ (Matthäus 28,19-20) musste als weitestgehend erfolgreich bewertet werden und auch bis heute sind ein Großteil der Menschen in Südafrika Christ*innen. Doch leider kommt es bis heute nicht mal zur Vereinigung aller lutherischen Christ*innen in Südafrika, die sich nach wie vor in unterschiedlichen kirchlichen Strukturen organisieren.
Dieses Überbleibsel einer Apartheid-Mentalität passte und passt für mich nicht in die gesellschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte eines bewussten „nation building“ auf Grundlage intensiver Versöhnungsarbeit. Trotzdem verteidigten viele Menschen aus meinem kirchlichen Umfeld immer noch Systeme der getrennten kirchlichen Entwicklung – obwohl es besonders in urbanen Gemeinden immer mehr zu einer großen Diversität in der Mitgliedschaft kommt. Sie tun das nicht aus Bosheit, sondern aus Überzeugung – einer Überzeugung, die ich schon als Teenager immer weniger teilen konnte. Ich stellte Fragen. Warum können wir den Wunsch Jesu nach einer vereinten Kirche nicht leben? Warum spricht man von „denen“ in einem Ton, der nicht dem Geist Jesu entspricht? Warum glaubt ihr, dass Ordnung wichtiger ist als Gerechtigkeit?
Ein Raum, in dem Identität neu verhandelt wird
Diese Fragen führten zu Reibung. Aber auch zu Gesprächen. Und sie führten mich an einen inneren Ort, den ich viel später in der Theorie von Homi K. Bhabha wiederentdeckte: den „Third Space“ – den „Dritten Raum“, in dem Identität nicht mehr klar zugeordnet werden kann, sondern neu verhandelt wird. Ein Raum zwischen den Kulturen, zwischen Systemen, zwischen Zugehörigkeiten. Ein Raum, in dem sich Widersprüche nicht auflösen, sondern fruchtbar werden.
Ich lebte – ohne es zu wissen – genau in einem solchen Raum. Ich gehörte zu einer weißen Familie, war Teil eines Systems, das Ungleichheit stützte. Und doch war da diese innere Unruhe, diese Suche nach einem anderen Weg. Ich war nicht mehr ganz Teil der alten Welt, aber auch nicht wirklich schon angekommen in der neuen. Ich war dazwischen. Zwischen Dogma und Zweifel. Zwischen Herkunft und Hoffnung.
In den nun neu entstehenden Gemeinden – oft eine Mischung aus alter Missionsgeschichte, Befreiungstheologie und neuem urbanem Glauben – hörte ich manchmal Predigten von Schwarzen Geistlichen, die mit ihrer bloßen Anwesenheit meine Vorstellungen ins Wanken brachten. Es war nicht, was sie sagten, sondern wie sie da waren. Mit einer Würde, die nicht eingefordert werden musste. Mit einem Glauben, der tiefer ging als jede Ideologie. Auch dieser Ort war ein „Third Space“ – ein Raum, in dem wir alle ein wenig Fremde waren, und gerade deshalb offen füreinander.
Ein Raum, in dem sich Gnade inmitten von Brüchen zeigt
Der Dritte Raum, wie Bhabha ihn beschreibt, ist ein Ort der Hybridität – ein Ort, an dem neue Bedeutungen entstehen, gerade weil Altes und Neues, Eigenes und Anderes, Rechtes und Fragwürdiges sich berühren. Für mich wurde er zu einem Denkraum, einem spirituellen Raum, einem ethischen Raum. Vielleicht ist das auch ein geistlicher Raum: dort, wo Gnade nicht sauber sortiert, sondern sich inmitten der Brüche zeigt.
Ich sehe heute, wie sehr mich dieser Raum geprägt hat – auch wenn ich ihn nie bewusst betreten habe. Er war da, zwischen den Fragen an meine Eltern und den Geschichten meiner Großeltern. Zwischen den Bibelversen, die wir in der Gemeinde hörten, und den Nachrichten aus Mamelodi. Zwischen meinem Schulweg durch die Vorstadt und der leisen Ahnung, dass meine Welt nicht die ganze Welt ist.
Und so glaube ich: Wer in Südafrika – oder vielleicht überhaupt in dieser Welt – ehrlich leben will, muss den Dritten Raum betreten. Muss aushalten, dass Identität nicht eindeutig ist. Dass Glaube manchmal mehr fragt, als antwortet. Dass Versöhnung nicht im Konsens liegt, sondern im gemeinsamen Aushalten der Differenz.
Denn genau dort – in der Spannung, im Zwischen – wohnt Gott.
Ulrich Meyer-Höllings
Verwandte Artikel

Kirche für alle – auch im Globalen Süden
Wir träumen von einer Kirche, die für alle offen und einladend ist. Eine Kirche, die inklusiv ist. Die Liste der Herausforderungen, die einer inklusiven…

Indigen und christlich – Widerspruch oder Bereicherung?
In Nagaland in Indien sind christliche Identität und indigene Stammesidentität historisch fest miteinander verbunden. Aber kann man indigen UND christlich…

Identität versus Vielfalt?
Männlich, weiblich, divers – Definitionen, die identitätsstiftend wirken und in ihrer Gesamtheit Vielfalt zeigen. Häufig ist nur eine Identität der einzelnen…
